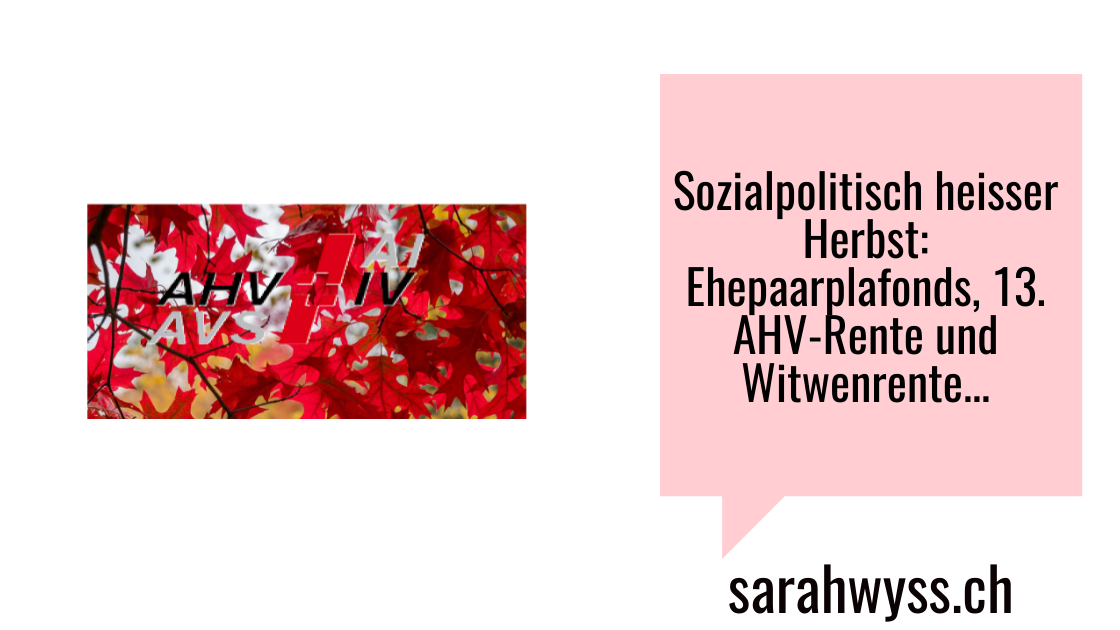(Dieser Text wurde für das Magazin Avivo am 10.8.2025 geschrieben)
Der Herbst 2025 verspricht innenpolitisch besonders heiss zu werden. Gleich drei bedeutende Reformen der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) stehen in Bundesbern zur Diskussion. Alle drei haben das Potenzial, das System der sozialen Sicherung langfristig zu prägen – teils im Sinne des sozialen Ausbaus, teils in Richtung Abbau. Die politischen Fronten verlaufen dabei nicht immer entlang klassischer Lager.
Umsetzung der 13. AHV-Rente: Im Frühjahr 2024 hat die Stimmbevölkerung die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente angenommen. Damit wurde ein klares Zeichen für mehr soziale Sicherheit und gegen den Kaufkraftverlust vieler Rentnerinnen und Rentner gesetzt. Die Herausforderung liegt nun in der Umsetzung: Wie soll diese zusätzliche Rente finanziert werden? Im Zentrum steht die Frage, ob die Mittel über Lohnprozente, Mehrwertsteuer oder Bundesbeiträge, oder in einer Kombination dieser Elemente, beschafft werden.
Initiative «Ja zu fairen AHV-Renten auch für Ehepaare»: Aktuell werden AHV-Renten für Ehepaare auf maximal 150 % der Maximalrente begrenzt. Die Volksinitiative der Mitte-Partei fordert, diese sogenannte Plafonierung aufzuheben. Damit würden Ehepaare grundsätzlich gleichgestellt mit Konkubinatspaaren. Die Initiative blendet jedoch bestehende Vorteile der Ehe – etwa Rentensplitting, Zuschläge für verwitwete Rentner oder die Witwenrente – vollständig aus. Viel wichtiger jedoch: Nur eine kleine Minderheit mit hohen Einkommen würde von dieser Änderung profitieren. Ehepaare mit tiefen Renten sind von der Plafonierung nicht betroffen und würden, wie Ledige, Geschiedene oder Verwitwete ganz leer ausgehen – müssten die Mehrkosten aber mittragen.
Reform der Hinterlassenenrenten: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Schweiz verpflichtet, die Ungleichbehandlung von Witwen und Witwern bei den AHV-Hinterlassenenrenten zu beseitigen. Während Witwen oft bis zur Pensionierung Renten erhalten, enden diese bei Witwern heute meist nach zwei Jahren. Der EGMR verlangt eine Angleichung. Statt jedoch Witwerrenten zu verbessern, schlagen Bundesrat und Teile des Parlaments Kürzungen bei den Witwenrenten vor. Damit würde eine menschenrechtlich gebotene Angleichung zur versteckten Abbaumassnahme – mit weitreichenden Folgen für viele Betroffene, vor allem Frauen mit Betreuungspflichten.
Mit meinem sozialdemokratischen Herzen wären meine Lösungen klar:
- Die 13. AHV-Rente soll solide und fair finanziert werden – über Lohnprozente und durch höhere Bundesbeiträge. Eine nationale Erbschaftssteuer könnte diese Bundesbeiträge mitfinanzieren.
- Die Initiative der Mitte lehne ich ab. Sie bevorzugt eine kleine Gruppe wohlhabender Ehepaare und führt zu neuen Ungleichheiten. Ein teurer Ausbau, der am Bedarf vorbeigeht, ist sozialpolitisch nicht vertretbar – vor allem, wenn damit Sparpakete drohen, die die sozial Schwächsten treffen.
- Die Hinterlassenenrenten sollten gleichgestellt werden – durch eine Aufwertung der Witwerrente, nicht durch Kürzungen bei den Witwen. Ergänzend braucht es zivilstandsunabhängige Absicherung für Menschen mit Betreuungspflichten, unabhängig vom Geschlecht.
Erste parlamentarische Entscheide zeigen, wie umkämpft die Dossiers sind. Während der Ständerat in der Sommersession 2025 einen Kompromiss zwischen Finanzierung der 13. AHV-Rente und Gegenvorschlag zur Mitte-Initiative vorschlug – getragen von Mitte und Linken –, hat der Nationalrat eine andere Richtung eingeschlagen. Dort wurde die Finanzierung der Mitte-Initiative mit Einschnitten bei den Witwenrenten verknüpft – ein SVP-Vorschlag, der sozialpolitisch inakzeptabel ist.
Die Debatten gehen nun weiter in den Kommissionen und Räten. Klar ist: Es braucht politischen Druck, damit die AHV nicht nur reformiert, sondern auch gestärkt wird – solidarisch, gerecht und zukunftstauglich.